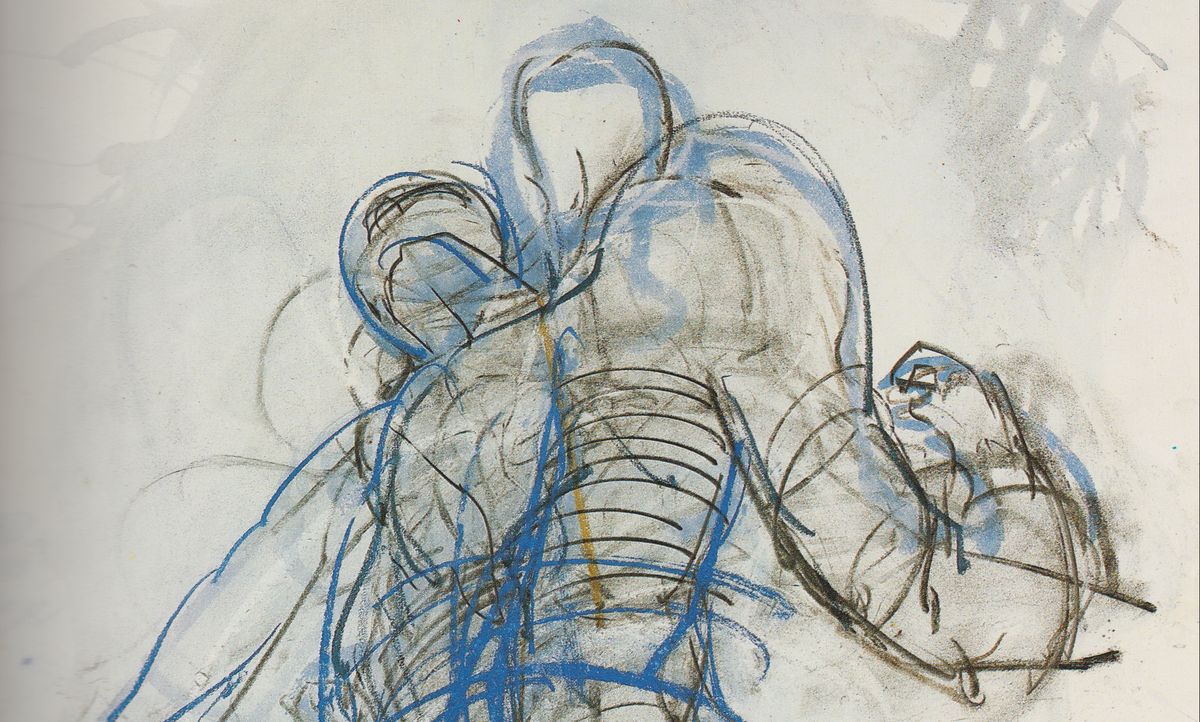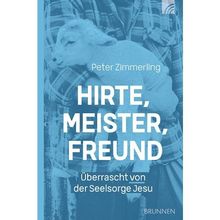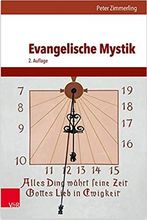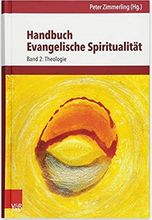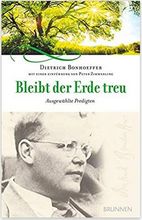Die Professur hat zwei Schwerpunkte: Seelsorge und Spiritualität, wobei für die Konzeption beider Unterdisziplinen der Praktischen Theologie der Dreischritt Geschichte, Theologie und Praxis konstitutiv ist. Ziel ist die Entwicklung eines neuen Modells der Zuordnung von Theologie und Humanwissenschaften und die Reflexion und Vermittlung der Vielfalt evangelischer Spiritualität im ökumenischen Kontext.
Professurinhaber
Aktuelle Publikationen
Aktuelle Rezension in der Theologischen Revue vom Februar 2025, erschienen im Aschendorff Verlag.
Forschungsprojekte
An der Forschungstagung zum Thema „Ein Gott, der richtet?“ in Leipzig am Montag und Dienstag, dem 10. und 11. Februar 2025 werden ca. 15 teilnehmen: ein Jurist, ein Musikwissenschaftler, ein Kunstgeschichtler – und sonst sind die einschlägigen theologischen Disziplinen vertreten.
Meine Vorstellung geht dahin, das Thema Zorn, Heimsuchung Gottes und Gericht in seiner ganzen Breite aufzunehmen: im AT und NT, in der Kirchengeschichte (Luther), in der Systematischen Theologie, in Liturgie und Predigt, in den Gesangbuchliedern, in der Musik, in der Jurisprudenz. Wie ich auf das Thema kam: Es ist während der Corona-Pandemie von verschiedenen – meist Kirchenmännern außer Dienst – beklagt worden, dass Theologie und Kirche der Gesellschaft, aber auch den Gemeinden, kein konkretes Wort angesichts der Krise zu sagen gehabt hätte. Das war auch meine Beobachtung. Meine These: Theologie und Kirche konnten dieses Wort deshalb nicht sagen, weil sie nur einen lieben Gott kannten, der lediglich die Aufgabe hat, das menschliche Handeln zu bestätigen oder, wenn mal etwas schief gelaufen ist, zu vergeben und zu trösten. So etwas wie die Corona-Pandemie hatte im vorherrschenden Gottesbild keinen Platz. Ein Gott, der durch Gericht und Gnade handelt – ja, dessen Gnade durch dessen Gericht wirkt („Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen“), ist inzwischen weithin unbekannt. Mein Eindruck ist: Wir haben uns in Theologie und Kirche (und ich fürchte, dass das nicht nur für den landeskirchlichen, sondern auch für den freikirchlichen Protestantismus gilt) längst von dem uns umgebenden säkularen Denken beeinflussen lassen, das höchstens für einen Gott Platz hat, der uns zu Diensten steht, mit Voltaire gesprochen, dessen Geschäft es ist zu vergeben.
Unter Berufung auf Luther, dass Gott seine Gewalt „gar heimlich“ führt, wird ein Gerichtshandeln Gottes im Grunde ausgeschlossen. Mir ist bewusst, dass Gott den Schwachen und den bußfertigen Sündern mit Liebe und Nachsicht begegnet. Aber gleichzeitig gilt: „Er stürzt die Gewaltigen vom Thron“. Das Ende von Diktaturen (1945 nach dem Dritten Reich, aber auch 1989 nach dem Ende des realexistierenden Sozialismus) veranschaulichte das in eindrucksvoller Weise.
Ich kann gut verstehen und auch theologisch mittragen, dass Gottes Allmacht neu – und d.h. differenzierter – als früher gedacht werden muss. Dass Gott nicht unmittelbar mit der Faust dreinschlägt, wenn sich irgendwo in der Welt oder im Himmel Unrecht zeigt, kann ja nicht geleugnet werden. Allerdings spüre ich in vielen gegenwärtigen systematisch-theologischen und praktisch-theologischen Überlegungen eine Tendenz, die auf eine Schwächung Gottes zugunsten anderer Mächte hinausläuft. Stattdessen möchte ich einerseits, dass Gott der bleibt, der für Gutes und Böses gleichermaßen letztverantwortlich ist – denn was wäre die Alternative? Letztlich doch ein schwacher Gott, der seine Macht mit anderen, d.h. schlussendlich bösen, Mächten teilen muss. Davor graust mir weit mehr als vor einem Gott, dessen Handeln ich nicht immer mit meiner Vernunft verstehen kann. Gott benutzt das Leid und die Not – ja sogar das Böse – und macht es unmittelbar für seine Zwecke dienstbar. Luther sagt, dass Gott sich vor allem (!) „durch die Fenster des dunklen Glaubens sehen lässt“. Ich selbst will in der Gewissheit leben und sterben dürfen, dass Gott in allem Geschehen handelt und ich deshalb nie und nirgends aus seiner Hand fallen kann – wie gesagt, auch wenn ich Gottes Tun häufig nicht verstehe.
Andererseits ist mir noch ein weiterer Gedanke wichtig: Mit Bonhoeffer gesprochen, reden und denken für mich Theologie und Kirche heute viel zu gemütlich von Gott – und das bei mittlerweile 900 000 Kirchenaustritten allein 2022 (ev. und kath. zusammengerechnet). Der biblische Gott ist alles aber andere als harmlos. Wehe, wer in die Hände des lebendigen Gottes fällt, heißt es sowohl im AT als auch im NT! Davon haben Theologen des vergangenen Jahrhunderts wie Karl Barth und Dietrich Bonhoeffer, aber auch Rudolf Otto noch etwas gewusst.
Wahrscheinlich haben die über 18 Jahre Leipzig mich hier noch einmal auf eine andere Spur als früher gebracht: In Leipzig leben 84 % der Bevölkerung (mit zunehmender Tendenz) gut auch ohne Gott. Mit anderen Worten: Ich glaube, dass – wenn überhaupt – eine Veränderung nur nach der Weise Jesu und der Propheten möglich ist: durch die Predigt des Gerichts. Ich muss allerdings zugeben, dass ich nicht weiß, wie diese heute konkret aussehen könnte. Der Antwort auf diese Frage näher zu kommen, wäre für mich eine Aufgabe des Forschungssymposiums.
Das Thema soll von den beteiligten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen jeweils aus dem eigenen fachspezifischen Blickwinkel betrachtet werden. Die Beiträge des Symposiums sollen im Frühjahr 2026 veröffentlicht werden. Wir haben an unserer Fakultät bereits eine Art Probelauf durchgeführt. Dabei konnte das Thema allerdings lediglich angerissen werden. Die Vorträge der Ringvorlesung „Ein Gott, der richtet?“ im Sommersemester 2021 sind 2023 als zwei Themenhefte in der Zeitschrift für Ev. Theologie erschienen. Auf dem Symposium geht es um eine Vertiefung des darin nur angerissenen Themas.
Ein weiteres Projekt erarbeitet eine spirituelle Seelsorgekonzeption. Trotz der Bedeutung, die die Seelsorge als eines der herausragenden Handlungsfelder für die Praktische Theologie besitzt, liegt die Veröffentlichung von entsprechenden konzeptionellen Neuentwürfen bald 20 Jahre zurück. Das gleiche gilt mutatis mutandis auch für die entsprechenden Lehrbücher. Es ist deshalb höchste Zeit, eine Seelsorgekonzeption zu erarbeiten, die die Herausforderungen der Gegenwart an die Seelsorge aufzunehmen und zu beantworten vermag. Dabei soll ein Lehrbuch entstehen, das auch digitale Formate integriert. Eines dieser Formate stellen Filme dar. Mit ihrer Hilfe sollen neue Zugänge und Perspektiven zu seelsorglichen Themen gewonnen werden. Ein weiteres dieser Formate sind Gemälde aus den unterschiedlichen Epochen der Kunstgeschichte bis in die unmittelbare Gegenwart. Die in der jüngeren Vergangenheit auch von anderen Praktischen Theologinnen thematisierte Verbindung von Kunst und Seelsorge soll in diesem Zusammenhang exemplarisch mit Hilfe der Betrachtung bedeutender Gemälde fortgeführt und vertieft werden.
Habilitationsprojekte
Promotionsprojekte
Katja Willunat, Spiritualität und Erneuerung - Theologie und Praxis der Oxfordgruppenbewegung in Deutschland
Die Oxfordgruppenbewegung ist eine der wichtigen Erweckungsbewegungen in Deutschland im 20. Jahrhundert. Der Fokus des Dissertationsprojekts liegt auf der Spiritualität der Bewegung und der ihr eigenen Praxis, zu deren besonderen Merkmalen die sog. Stille Zeit, die Einzelbeichte und die Suche nach persönlicher "Führung" durch den Heiligen Geist gehörten. Aus dieser Spiritualität entspringen nicht nur die hohen ethischen Maßstäbe der Bewegung, sondern auch die Perspektive einer positiven Beeinflussung der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse. Das aus heutiger Sicht problematische Agieren der Gruppenbewegung im politischen Kontext des Dritten Reiches wird im Dissertationsprojekt damit in Bezug gesetzt. Aus dem Wirken und den Ansätzen der Gruppe werden Impulse für die Gegenwart abgeleitet.
Timo Andreas Doetsch (Doktorand Theologische Fakultät der Universität Freiburg (CH) bei Frau Prof. Dr. Barbara Hallensleben, Gaststatus in Leipzig), Testimoniale Theologie. Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt.
Das Doktoratsprojekt untersucht, welchen Beitrag die Entstehung, der Inhalt und die Rezeption des „Christian Witness in a Multi-Religious World“ (2011) für die Theologie der Mission und Ökumene leisten. Der Text stellt eine bahnbrechende Einigung über die Konfessionsgrenzen hinweg dar.
Inhaltlich behandelt das ökumenische Dokument die Art und Weise, wie das christliche Zeugnis ausgeführt werden sollte. Anhand der drei genannten Bereiche wird erforscht, mit welchen Impulsen dieser praktische Text die Theologie bereichert. Die dem Projekt zugrundeliegende These ist, dass von dem Dokument ein friedensstiftendes Potenzial ausgeht – sowohl innerchristlich als auch interreligiös.
Tobias Dietze, Der Erweckungsprediger Ludwig Hofacker. Biographie, Spiritualität, Rhetorik – eine homiletische Studie
Ludwig Hofacker war der bedeutendste Erweckungsprediger Württembergs und prägte durch seine Predigttätigkeit und Predigtbände die Landeskirche wie kaum ein anderer. Das Dissertationsprojekt fragt, wie seine Homiletik durch biografische Umstände, seine Spiritualität und seine Rhetorik charakterisiert wurde und zum Impulsgeber für eine neue Homiletik werden kann.
Aurel Everling, Leib- und Seelsorge bei unerfüllter Sexualität
„Ja, es gibt wichtigere Probleme. Aber nicht für die Betroffenen. Und wie sollen wichtigere Probleme gelöst werden, wenn schon bei den weniger wichtigen die Kreativität versagt? Daher dieses Buch“ (Wilhelm Schmid, Sexout) – und daher diese Arbeit, die nach kreativen Lösungen im kirchlichen Kontext sucht.
Paul Geck, Gemeinschaft und Kirche. Eine interdisziplinäre Untersuchung zum Gemeinschaftsbegriff und gemeinschaftlichen Sozialformen im Kontext der Kirchentheorie
Der Gemeinschaftsbegriff wird in dieser Arbeit aus biblisch- und systematisch-theologischer, soziologischer und sozialphilosophischer Perspektive untersucht, sodann in Beziehung zu den Ergebnissen einer empirischen Untersuchung dreier ökumenischer Kommunitäten gesetzt und schließlich im Kontext der Kirchentheorie verortet.
Gemeinschaft ist ein schillernder Begriff, der vielfältige Assoziationen – und Emotionen – weckt, sowohl positive als auch negative. In den Sozialwissenschaften wird diese Spannung zwischen den Polen Mythos (ursprünglich, natürlich) und Konstrukt (künstlich, imaginiert) gefasst. Gemeinschaft als Ideal ist eine Folie, die auf vielfältige Weise verwendet werden kann. Immer wieder taucht der Begriff in den Debatten über den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf, wobei der Wert partikularer Gemeinschaften für eine liberale Gesellschaft umstritten ist. Diese Spannung zeigt sich, wenn auch häufig implizit, in der deutschsprachigen ev. Kirchentheorie. Sozialformen der Nähe, von Familie über Ortsgemeinde bis zu Gruppen und Bewegungen, kommen nur am Rande vor, auf empirische Untersuchungen kann kaum zurückgegriffen werden. Dabei ist die christliche Kirche schon durch ihr Glaubensbekenntnis, in der sie sich selbst als „Gemeinschaft der Heiligen“ bekennt, auf den Begriff verwiesen. Greift man auf neutestamentliche Texte zurück, zeigt sich Kirche hier im hohen Maß als intensive Sozialform. Zentrale Konflikte in den paulinischen Briefen (Beschneidung, Reinheitsgebote, Götzenopferfleisch) haben ihren Sitz im Leben in der konkreten Tischgemeinschaft einer konkreten Gemeinschaft.
Was bedeutet es, dass Kirche Gemeinschaft ist? Zentrale Einsichten Dietrich Bonhoeffers, der dieser Frage seine erste wissenschaftliche Arbeit widmete, weisen hier den Weg. Hundert Jahre nach seinem Buch „Sanctorum Communio“ stellt sich zudem die Frage, wie sich die veränderten soziologischen Voraussetzungen auf eine Theorie der Kirche auswirken. Ausgehend auch von den soziologischen und sozialphilosophischen Ergebnissen soll gefragt werden, ob die Gemeinschaft der Heiligen anders gedacht werden muss, wenn aus einer religiös relativ homogenen Gesellschaft eine – grob gesagt – postsäkulare Gesellschaft wird.
Dem Empiriedefizit der Kirchentheorie in Bezug auf gemeinschaftliche kirchliche Formen soll durch eine Untersuchung von zwei deutschen und einer italienischen Kommunität begegnet werden. Kommunitäten sind eine Form von kirchlichen Sozialformen der Nähe, wenn auch eine höchst intensive. Für eine qualitative Studie über konkrete Fragen des gemeinschaftlichen Lebens bieten sie sich vor allem durch ihre über Jahrzehnte bestehende Konstanz an, die andere Sozialformen der Nähe nur äußerst selten zu erreichen vermögen.
Benjamin Hummel, Heilsvergewisserung als Trost. Eine Untersuchung zur Seelsorge Johann Gerhards (1582–1637) an Kranken und Trauernden und ihre Relevanz für die heutige Poimenik
Johann Gerhard gilt als großer Dogmatiker der Lutherischen Orthodoxie. Sein Wirken als Seelsorger wird selten wahrgenommen. Dieses Projekt untersucht Gerhards Seelsorge im Kontext von Krankheit und Trauer anhand seiner Briefe und Erbauungsschriften und fragt, welche Impulse sich daraus für gegenwärtige poimenische Diskurse gewinnen lassen.
Stephanie Martin, Ehrenamtliche Verkündigung zwischen Gemeinde und Pfarramt
Ehrenamtliche Verkündigung rückt immer mehr in das Interesse der kirchlichen Öffentlichkeit. Der regelmäßige Sonntagsgottesdienst, lokal eingebunden und damit erreichbar für alle Generationen, könnte abseits der Großstädte ohne den Lektoren- und Prädikantendienst kaum noch aufrechterhalten werden. Erstaunlicherweise wurde dem Prädikantendienst mit seiner selbstverantworteten Verkündigung in der praktisch-theologischen Forschung bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Er soll in diesem Dissertationsprojekt in seinen heterogenen kirchenrechtlichen Ausgestaltungen in den Gliedkirchen der EKD in den Blick genommen werden. Schwerpunkt liegt auf der kritischen Reflexion der ekklesiologischen und amtstheologischen Begründungsmuster dieses Dienstes. Das betrifft insbesondere die Themen: Das Allgemeine Priestertum, das Verhältnis von Prädikantendienst und Pfarramt und die Frage nach der Ordination von Prädikanten. Kontroverse Auffassungen werden dargestellt, anhand von biblischen und historisch-systematischen Linien auf ihre Plausibilität untersucht und mit Blick auf den gegenwärtigen Prädikantendienst praktisch-theologisch ausgewertet.
Albrecht Meinel, Theologie der Ortsgemeinde. Emil Sulzes Gemeindeideal in der kybernetischen Diskussion.
Der sächsische Pfarrer Emil Sulze (1832–1914) gilt als Begründer des neuzeitlichen Gemeindebegriffs. Das Projekt widmet sich insbesondere seinem Gemeindeideal, das die Ortsgemeinde als Subjekt kirchlichen Handelns ins Zentrum seiner Theologie rückt. Ausgehend von Sulze wird auch nach Impulsen für die gegenwärtige kybernetische Diskussion gefragt.
Marie Isabel Thiede, Beichte und Vergebung der Sünden. Überlegungen zu ihrer Relevanz auf dem Hintergrund heutiger theologischer und philosophischer Diskurse
Das allgemeine Ziel der Untersuchung besteht darin, das theologische Konzept und die kirchliche Praxis der Beichte und der Sündenvergebung in der lutherischen Tradition zu analysieren und ihre Relevanz in der heutigen Zeit angesichts neuer Schuld Konfigurationen hervorzuheben, die sich aus den Erwartungen ergeben, die von den Werten des Marktes mit seiner Dominanz und seinem Leistungsanspruch geprägt sind – eine Realität, die durch die neoliberale Psychopolitik noch verstärkt wird.
Steffen Tiemann, Die Kraft der Gewohnheit. Das Zusammenwirken von habit formation und spiritual formation.
In der Dissertation wird die Relevanz der Gewohnheitsbildung für die spirituelle Lebensgestaltung untersucht. Dazu werden die aktuellen sozialpsychologischen Forschungsergebnisse zur Gewohnheitsbildung in Beziehung gesetzt zu exemplarisch vorgestellten Reflexionen zur Bedeutung von Gewohnheiten für die Glaubenspraxis und Charakterbildung aus verschiedenen Epochen der Kirchengeschichte. Schließlich soll eruiert werden, inwiefern die aktuellen sozialpsychologischen Erkenntnisse zur Gewohnheitsbildung und die Einsichten aus der Geschichte der christlichen Spiritualität für die Gegenwart fruchtbar gemacht werden können.
Sérgio Selke, Gemeindeaufbau und Evangelisation: Die Beiträge der Glaubenskurse zum Wachstum und zur Entwicklung der Evangelischen Kirche Lutherischen Bekenntnis in Brasilien (IECLB)
Das Thema Glaubenskurs kam Ende des 20. Jahrhunderts auf und wurde durch einen säkularisierten und individualisierten europäischen Kontext motiviert, um den Austritt der christlichen Kirchenmitglieder zu mildern. Brasilien ist eines der größten christlichen Länder der Welt und sehr religiös, was es zu einem wettbewerbsfähigen und dynamischen religiösen Markt macht. Die lutherische Kirche, die vor allem von europäischen Einwanderern gegründet wurde, erlebt ebenfalls einen Rückgang der Mitgliedszahlen. Obwohl der europäische und der südamerikanische Kontext unterschiedlich sind, werden in beiden Glaubenskurse durchgeführt. Ausgehend von diesen Erkenntnissen zielt die Untersuchung darauf ab, den Einsatz von Glaubenskursen in der Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasilien in einem anderen Kontext als dem säkularisierten europäischen zu verstehen. Auf diese Weise soll die Forschung die Kriterien erhellen, die von der brasilianischen lutherischen Kirche verwendet werden, um solche Materialien in ihre Realität zu übernehmen, ohne dabei den europäischen Ursprung der Glaubenskurse aus den Augen zu verlieren. Die Dissertation zielt darauf ab, ein theologisches Konzept zu entwickeln, das es ermöglicht, den Einsatz von Glaubenskursen in verschiedenen Kontexten zu verstehen, sowie einen möglichen Erfahrungsaustausch im Bereich der praktischen Theologie.
Sebastian D. Schirmer, „Einander anerkennen“ Transversale Seelsorge als Sorge um gelingende Gemeinschaft
Menschen leben in Gemeinschaft. Aber gelingt Gemeinschaft dabei auch jeweils? Bei der Untersuchung von Gemeinschaft und der Frage nach ihrem Gelingen braucht es geeignete Instrumente. Als solche werden die Begriffe Anerkennung und Seelsorge im Rahmen christlicher Gemeinschaft vorgeschlagen und vorgestellt.
Martin Henninger, Die Relevanz von Spiritualität für Fresh Expressions of Church
Die sich verändernde Rolle der Kirchen in der Gesellschaft der letzten 50 Jahre wird meist als Säkularisierung beschrieben. Man kann sie jedoch auch als Entwicklung von institutioneller Religion hin zu individueller Spiritualität verstehen („Refiguration der Religion“); das sog. „Marktmodell“ bietet einen weiteren Erklärungsversuch. Fresh Expressions of Church wollen dem Bedeutungsverlust der Kirche mit einer neuen Form von Kirche begegnen. Grundlegend für Fresh X ist eine Veränderung der Blickrichtung weg von einer Binnensicht hin zu einer Wahrnehmung der Bedürfnisse von Menschen. Meine Fragestellung erkundet die Rolle der Spiritualität in diesem Prozess, und zwar in doppelter Richtung: Einmal in Bezug auf die in Fresh X-Projekten Mitarbeitenden und zum zweiten in Bezug auf die Sehnsucht und die Bedürfnisse der Menschen, die in diesen Projekten aufgenommen wird. Dabei wird die Situation in Großbritannien, wo die Fresh X-Bewegung ihre Wurzeln hat, mit der Situation in Deutschland verglichen.
Kevin Hosmann: Queersensible Seelsorge im Rahmen von Kirche und Gesellschaft
Das Dissertationsprojekt betrachtet das Verhältnis von evangelischer Seelsorge und queeren Menschen in einem historischen Kontext, wobei der Schwerpunkt auf der Frage nach seelsorglichen Anknüpfungspunkten an gesellschaftliche und humanwissenschaftliche Entwicklungen liegt. Dabei wird zum einen retrospektiv vorgegangen, indem die Rolle von Theologie und Kirche in Bezug auf die Identität und Diskriminierung queerer Menschen an zahlreichen kirchlichen Verlautbarungen, theologischen Gutachten und kirchenpolitischen Vorgängen dargestellt und analysiert wird. Zum anderen wird, bereits bestehende Ansätze integrierend, perspektivisch eine queersensible Seelsorge skizziert, die keine Form einer Sonderseelsorge darstellt, aber besonders aufmerksam für die spezifischen Herausforderungen queerer Seelsorgesuchender sein muss.
Abgeschlossene Promotionsprojekte
Nach Luthers „Torgauer Formel“ ist Gottesdienst ein Zusammenspiel von göttlichem und menschlichem Handeln – das Göttliche nur durch das Menschliche hindurch, das Menschliche immer vom Göttlichen ermöglicht und bedingt. Der Gottesdienst als menschliches Handeln steht im Zeichen der Erwartung, was spiritualitätstheologisch zu beschreiben ist.
Abgeschlossene Promotionsprojekte
Silke Sommerkamp, Spiritualität in der Gemeindeberatung – eine kirchentheoretische Reflexion
Notwendige Veränderungsprozesse im Raum der Kirche werden oft von externen Beratern begleitet. Kann, darf oder muss Spiritualität Teil solcher Beratungsprozesse sein? Welche Chancen und Gefahren birgt eine geistliche Prozessbegleitung? Und welche kirchentheoretischen Vorentscheidungen stehen hinter den unterschiedlichen Beratungskonzepten?
Thomas Thiel, Frei-Sprechen und Wahr-sagen. Seelsorgliche Begleitung traumatisierter Menschen im Kontext von Scham, Schuld, Macht und Gewalt
Ausgehend von mehrjährigen Erfahrungen als Militärpfarrer an Bundeswehrkrankenhäusern und einem Auslandseinsatz in Afghanistan beschreibt Herr Thiel die Situation traumatisierter Menschen. Dabei stellen sich die Themenkreise Scham und Schuld sowie Gewalt und Macht als wichtigste dar. In Diskursen mit dem Werk Michel Foucaults und zeitgenössischer Literatur wird versucht, eine hermeneutische Grundlage für das poimenische Handeln zu erarbeiten. Daraus ergibt sich ein neuer poimenischer Ansatz, der bisherige Seelsorgekonzepte erfahrungsbasiert so ergänzt, dass die Relevanz der theologischen Auseinandersetzung mit dem Traumaspektrum deutlich wird. Die Überlegungen leiten dazu an, die leibliche, spirituelle und politische Dimensionen der Seelsorge intensiver in den Blick zu nehmen und daraus die nötigen Konsequenzen zu ziehen.
Keller, David: Zinzendorfs Rhetorik. Eine Untersuchung zur Predigt zwischen Methode und Heiligem Geist, Hallesche Forschungen, Bd. 65, Verlag der Franckeschen Stiftungen Halle, Halle 2023 (Promotion 2020).
Liebscher, Tobias: Anfechtung. Die Spiritualität der Anfechtung in Martin Luthers Seelsorge und ihre Bedeutung für die gegenwärtige Hermeneutik, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2023 (Promotion 2021).
Johannes Schütt: „Die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören.“ Konzeptionen der Kirchentheorie im kritisch-theologischen Vergleich
Schütt, Johannes: „Die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören.“ Konzeptionen der Kirchentheorie im kritisch-theologischen Vergleich, wbg Academic in Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2023 (Promotion 2022).
Glatz, Winfried: Eine unstete Beziehung. Die homiletische Rezeption psychologischer und psychotherapeutischer Konzepte dargestellt anhand wesentlicher Ausprägungen des 19. und 20. Jahrhunderts und weitergeführt am Beispiel hypnotherapeutischer Interventionen, Arbeiten zur Pastoraltheologie, Liturgik und Hymnologie, Bd. 98, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2022 (Promotion 2019).
Judith Braun, Dietrich Bonhoeffers gemeindepädagogisches Wirken im Rahmen seines Kirchenverständnisses, Arbeiten zur Religionspädagogik, Bd. 67, Vandenhoeck & Ruprecht unipress, Göttingen 2019 (Promotion 2017).
Markus Schmidt, Charismatische Spiritualität und Seelsorge. Der Volksmissionskreis Sachsen bis 1990, Kirche – Konfession – Religion, Bd. 69, Vandenhoeck & Ruprecht unipress, Göttingen 2017 (Promotion 2016).
Wilfried Sturm, „Was soll man da in Gottes Namen sagen?“ Der seelsorgerliche Umgang mit ethischen Konfliktsituationen im Bereich der Neonatologie und seine Bedeutung für das Verhältnis von Seelsorge und Ethik, Arbeiten zur Pastoraltheologie, Liturgik und Hymnologie, Bd. 82, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015 (Promotion 2013).
Christian Samraj Arputharaj, Preaching amidst culture: An intercultural homiletic study of the Tranquebar missionaries in the 20th century – with special reference to missionaries Siegried Zehme, Arno Lehmann und Dietrich Winkler (unveröffentlicht) (Promotion 2011).
Dirk Kellner, Charisma als Grundbegriff der Praktischen Theologie. Die Bedeutung der Charismenlehre für die Pastoraltheologie und die Lehre vom Gemeindeaufbau, Theologische Verlag Zürich, Zürich 2011 (Promotion 2009)
Studentische Hilfskräfte
Johann Mende
Sophie Schmid
Christoph Schlicker
Tim Hagemann